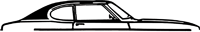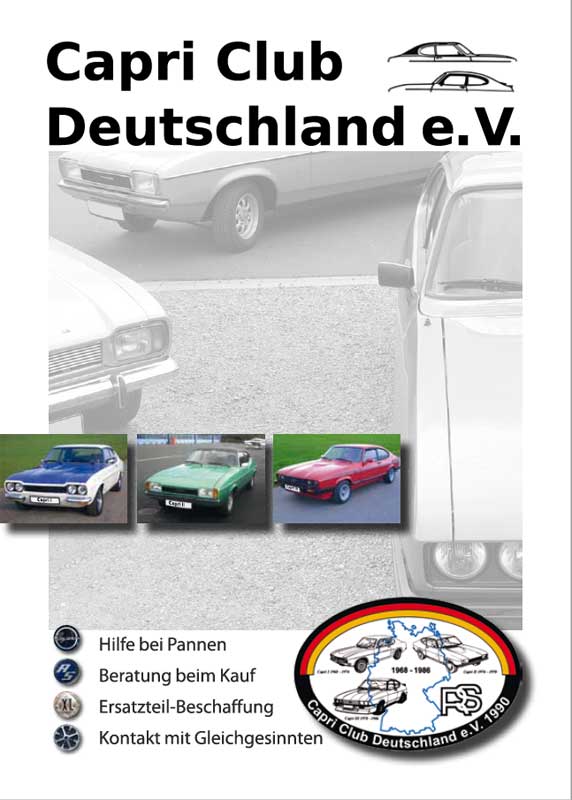ADAC positioniert sich eindeutig gegen Vorstoß aus Brüssel zur jährlichen HU für ältere Autos
Am 24. April dieses Jahres hat die EU-Kommission einen Legislativvorschlag zur Änderung der Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahr-zeuganhängern vorgelegt. Dabei geht die EU-Kommission davon aus, dass sicherheitsrelevante Mängel sowie Defekte und Manipulationen der Abgasnachbehandlung mit höherem Fahrzeugalter zunehmen. Die EU-Kommission schlägt daher, wie bereits in einzelnen Mitgliedsstaaten geregelt, jährliche Hauptuntersuchungen für Fahrzeuge vor, die älter als zehn Jahre sind. Der ADAC nimmt dazu wie folgt Stellung.
Mit Blick auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit hält der ADAC die vorgeschlagene jährliche Überprüfung für unverhältnismäßig, da keine signifikant höhere Unfallgefährdung durch ältere Fahrzeuge feststellbar ist. Die Verkehrsunfallforschung der TU Dresden hat in einer Studie im Auftrag des ADAC nachgewiesen, dass eine Verkürzung der HU-Fristen auf ein Jahr keinen messbaren Einfluss auf die Verkehrssicherheit hat. Dank regelmäßiger, sachverständiger und umfassender technischer Inspektionen zeichnet sich die deutsche Fahrzeugflotte durch eine geringe Quote technischer Mängel aus. Zudem sind nur wenige der festgestellten Mängel unfall- beziehungsweise sicherheitsrelevant.
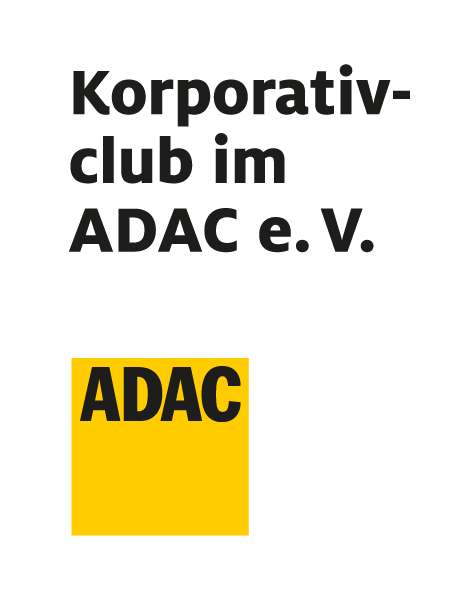
Klarer Zusammenhang unbelegt
Die Einführung einer jährlichen Hauptuntersuchung ist aus verkehrssicherheitstechnischer Sicht nicht verhältnismäßig. Technische Mängel sind nach Berichten des statistischen Bundesamts nur selten Hauptursache bei Unfällen mit Personenschaden. Im Jahr 2023 starben 2.830 Menschen im Straßenverkehr, davon waren 25 Todesfälle (0,88 Prozent) auf technische Mängel zurückzuführen. Ein klarer Zusammenhang zwischen HU-Mängeln und Unfallzahlen ist nicht belegt, da die Datenlage zu ungenau ist. Auch internationale Vergleiche zeigen keine signifikanten Veränderungen bei Unfallzahlen in Ländern wie Finnland, Irland, den Niederlanden, Polen, Portugal, Spanien und Schweden nach Änderung der Prüfintervalle.
Technische Mängel verursachen weniger als ein Prozent der tödlichen Unfälle, viele davon sind durch die HU nicht zu verhindern. Eine jährliche HU würde einen hohen Aufwand bedeuten, ohne dass ein relevanter Sicherheitsgewinn nachweisbar ist. Eine detailliertere Datenerhebung ist nötig, bevor eine solche Maßnahme gerechtfertigt werden kann.
Mit Blick auf die Verbesserung der Luftqualität setzt die Folgenabschätzung der EU-Kommission auf eine unzureichende Datenlage. Die Kommission räumt ein, dass wenig Informationen über den Anteil der Fahrzeuge mit defekter oder manipulierter Abgasreinigung vorliegen. Die pauschale Darstellung der EU-Kommission ist an dieser Stelle nicht zielführend, da eine Abschätzung nach Fahrzeugtyp (Antriebstechnologie, Abgasreinigungsstandard) und Altersklasse für einzelne Mitgliedsstaaten erforderlich ist. Nur so kann die nationale Betroffenheit eingeschätzt werden. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland alle Grenzwerte zur Luftqualität eingehalten. Eine Verkürzung des Prüfintervalls mit dem Ziel, die Luftqualität zu verbessern, ist daher weder notwendig noch effizient.
1,8 Milliarden zusätzliche Belastung
Das Durchschnittsalter von Pkw liegt in Deutschland bei 10,6 Jahren. Eine Verkürzung der Prüffristen würde mehr als 23,4 Millionen Fahrzeuge betreffen – das entspricht rund 47,1 Prozent des Gesamtbestands. Unter Zugrunde-legung durchschnittlicher Kosten von 150 Euro pro Hauptuntersuchung ergibt sich daraus eine zusätzliche jährliche Belastung von rund 1,8 Milliarden Euro für die Halter älterer Fahrzeuge. Vor dem Hintergrund dieser erheblichen finanziellen Mehrbelastung sowie der Ergebnisse der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden, die keinen signifikanten Sicherheitsgewinn durch verkürzte Prüfintervalle für ältere Fahrzeuge erkennen lässt, erscheint eine solche Maßnahme unverhältnismäßig.
Einordnung bezüglich Oldtimer
Die Kollegen der Autobild Klassik haben zum Thema einmal eine Einordnung vorgenommen. Eingangs wird darin darauf verwiesen, dass es sich zunächst lediglich um einen Vorschlag der Europäischen Kommission handelt. Das EU-Parlament wird über den Vorschlag beraten und mögliche Änderungen vorschlagen. Anschließend wird es in Verhandlungen mit der Kommission und dem Rat (der die Mitgliedsstaaten vertritt) die finale Überarbeitung der Richtlinie festzurren. Danach werden die nationalen Parlamente die Richtlinie in nationales Recht gießen. Das heißt für Deutschland: der Bundestag wird auf Grundlage der Richtlinie (die nur das Ziel vorgibt, aber die konkrete Umsetzung den Mitgliedstaaten überlässt) ein Gesetz erarbeiten und beschließen.
Das in Rede stehende Papier ist ein Zusatz zur Direktive 2014/45/EU über „periodic roadworthiness tests for motor vehicles“ (regelmäßige Verkehrssicherheitsprüfungen für Motorfahrzeuge). Und da steht eine Ausnahme drin. In dieser heißt es, dass die Mitgliedsstaaten bei „Fahrzeugen von historischem Interesse“ über die HU-Intervalle entscheiden sollen. Damit kann Deutschland über die Hauptuntersuchungen für Fahrzeuge mit H-Kennzeichen eigenständig entscheiden. 07-er Kennzeichen sind ohnehin außen vor.
Zu bilanzieren bleibt, dass nach den vorliegenden Daten eine jährliche HU für Oldtimer weder deren Schadstoffausstoß noch deren Unfallhäufigkeit messbar verringern würde. Denn gerade Oldtimer mit H-Kennzeichen sind fast durchgängig gut gewartet und gepflegt, werden im Durchschnitt nur etwa 1.000 Kilometer pro Jahr gefahren und verursachen schon jetzt extrem wenige Unfälle.
Was kann nun jeder von uns tun? Sprecht mit dem Europaageordneten Eures Wahlkreises, sprecht mit dem Bundestagsabgeordneten Eures Wahlkreises! Tragt den Volksvertretern vor, wie Ihr die Sache seht!
[Text & Grafik: ADAC]